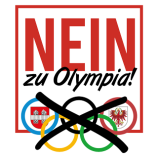Kontakt
Stefan Grass
Leiter von 2000 bis 2022 des Komitees Olympiakritisches Graubünden
Zusammenfassung

Olympische Spiele - ein Auslaufmodell?
2019: Kaum jemand möchte noch Olympische Winterspiele. Das liegt auch an einem harten Gegner aus der Schweiz.

Olympia ist ein Auslaufmodell
2018: Seit den Olympischen Winterspielen in Turin 2006 zeigt sich die fehlende Sinnhaftigkeit von solchen Sportgrossveranstaltungen im Alpenraum. Stefan Grass, Leiter des Komitees Olympiakritisches Graubünden, der seit 18 Jahren die Kandidaturen für Olympische Winterspiele in Graubünden für 2010, 2014, 2022 und 2026 erfolgreich bekämpfte, zieht Bilanz.
Der Spieleverderber
2018: Stefan Grass hat die Kandidatur für Olympische Spiele in Graubünden gebodigt. Jetzt soll er Sion 2026 verhindern.
Internationale Medien
Mauspfeil auf dem Titel zeigt Medium, Datum und Lead:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
2025
2026
Kann Mailand-Cortina der Wendepunkt der Winterspiele sein? Das IOK muss tiefgreifende Reformen anstossen
05.02.2026
Aufgeblasene Programme und hohe Infrastrukturkosten haben dem Ruf der Olympischen Winterspiele geschadet. Um wieder attraktiv zu werden, brauchen sie eine zeitgemässe Vergabepraxis. Doch das allein reicht nicht. (Kommentar von Christof Krapf, NZZ)
Die
Olympischen Winterspiele haben einen miserablen Ruf. Diese Misere hat
das Internationale Olympische Komitee (IOK) selbst geschaffen. Es vergab
die vergangenen drei Austragungen an Russland, Südkorea und China.
Olympia 2014, 2018 und 2022 waren verbunden mit Kritik an ausufernden
Infrastrukturkosten und der mangelnden Nachhaltigkeit von Sportstätten.
Kritiker monierten ausserdem Umweltschäden und die teilweise
autokratischen politischen Systeme der Gastgeberländer.
Die
Krise der Winterspiele hat mehrere Ursachen. Ihnen fehlt eine
Weltsportart als Zugpferd. Sie sind dadurch in vielen Teilen der Welt
irrelevant, zum Beispiel in Südamerika und weiten Teilen Asiens. Hinzu
kommen Disziplinen wie Skispringen oder Bob, die in nichtolympischen
Jahren ein Schattendasein fristen, an den Olympischen Spielen allerdings
teure Infrastruktur benötigen. Es verwundert nicht, dass das Interesse
an Winterspielen gesunken ist: beim finanziell relevanten TV-Publikum,
aber auch bei potenziellen Ausrichtern. Das wirft die Frage auf, ob
Olympische Winterspiele in der heutigen Form noch zeitgemäss sind.
Teure
Sportstätten, die nach den Spielen ungenutzt verfallen, sind ein Symbol
der Krise. Die Sprungschanzen in Sotschi kosteten umgerechnet 230
Millionen Euro, schon während Olympia 2014 zeichnete sich ab, dass sie
wegen des weichen Untergrunds zu wenig stabil für eine langfristige
Nutzung sein würden. Das olympische Teamspringen war der letzte
internationale Wettkampf, der auf diesem Millionengrab stattgefunden
hat.
Auf der Bobbahn in Yanqing,
im Hinblick auf Peking 2022 gebaut, wurden 2023 einmal Weltcup-Rennen
ausgetragen, seither waren nur noch unterklassige Wettkampfserien zu
Gast. Dass das die kolportierten Baukosten von 500 Millionen Dollar
rechtfertigen soll, ist schwer vermittelbar. Die Geschichte der
Winterspiele ist reich an solchen Mahnmalen.
Das
IOK ortete lange keinen Handlungsbedarf. Warum auch? Es gab
schliesslich Staaten wie Russland und China, die ihr Image mit
Winterspielen aufpolieren wollten und dafür viel Geld ausgaben. Das ging
so lange gut, bis der ramponierte Ruf dazu führte, dass das IOK Mühe
bekundete, Ausrichter zu finden.
Olympiaprojekte
in Calgary, Tirol, Graubünden, im Wallis und in München wurden von der
Stimmbevölkerung oder der Politik noch vor dem Bewerbungsprozess
abgeklemmt. Zuletzt veränderte das IOK deshalb die Vergabepraxis, es
trat in einen direkten Dialog mit potenziellen Olympiastädten – ein
richtiger Schritt, der verhindert, dass sich Gastgeberstädte mit
extravaganten Konzepten überbieten.
Kompromiss auf Kosten von Athletinnen und Zuschauern
Die
Winterspiele kehren in Norditalien nach zwanzig Jahren Absenz zurück in
die Alpen. Mailand-Cortina 2026 soll ein Wendepunkt werden: weg vom
Gigantismus, hin zu nachhaltigen Spielen, zurück in demokratische
Politsysteme und in das Ursprungsgebiet des Wintersportes. Das ist eine
erfreuliche Nachricht.
Doch
die Rückkehr in die Alpen hat ihren Preis: Dezentralisierung.
Mailand-Cortina 2026 wird an fünf sogenannten Clustern ausgetragen, das
IOK ist diesen Kompromiss eingegangen, auf Kosten der Athletinnen und
Zuschauer. Die Austragungsorte liegen weiter voneinander entfernt als
zuletzt.
Einen
Austausch unter Athletinnen und Athleten verschiedener Sportarten wie
an früheren Spielen wird es kaum geben. Auch für die Zuschauer birgt
Mailand-Cortina logistische Herausforderungen. Die Autofahrt von
Mailand, wo die Eissportarten und die Eröffnungsfeier stattfinden, zu
den Biathletinnen in Antholz dauert fünf, mit dem öffentlichen Verkehr
sogar gegen sieben Stunden.
Der
vielzitierte olympische Geist dürfte einen schweren Stand haben. Zu
befürchten ist, dass isolierte Wettkämpfe stattfinden, die Kulissen eher
Weltmeisterschaften oder Weltcups denn Olympia gleichen. Der Beweis
muss zuerst erbracht werden, dass unter diesen Umständen Olympiastimmung
aufkommt und der Funke von den Sportlerinnen auf die Bevölkerung und
das Publikum überspringt.
Dennoch
ist der Schritt richtig, weil er Kosten spart. Die Spiele 2014 kosteten
den russischen Staat über 50 Milliarden Dollar, für jene in Peking ist
es schwierig, genaue Zahlen zu erhalten, Schätzungen gehen von 38,5
Milliarden Dollar aus. So oder so: Mit etwa 7 Milliarden Dollar werden
die Winterspiele in Mailand-Cortina die günstigsten der jüngeren
Geschichte sein.
Dies,
weil vor allem bestehende Sportstätten und Tourismusinfrastruktur
genutzt werden – abgesehen von der Bobbahn in Cortina, die für 120
Millionen Euro neu gebaut wurde. Die deutlich günstigere Sanierung der heute unbenutzten Bahn der Spiele 2006 in Cesana lehnte die Regionalregierung des Veneto ab.
Drei
Viertel der Investitionen in den Verkehr wurden für Strassen
aufgewendet. Der öffentliche Verkehr hingegen kam zu kurz. Obendrein
werden zahlreiche Infrastrukturprojekte erst lange nach den Spielen
fertiggestellt, und auch andere Versprechen an die einheimische
Bevölkerung sind noch nicht eingelöst. Wie nachhaltig Mailand-Cortina
2026 tatsächlich ausfällt, wird sich erst in der Rückschau bewerten
lassen.
Die Schweiz und Frankreich werden genau hinschauen
Die
Winterspiele 2026 werden ein Anlass, der aus der Schweiz und Frankreich
genau beobachtet wird. Frankreich richtet Olympia 2030 aus, ebenfalls
mit einem dezentralen Konzept, das Austragungsorte zwischen den Alpen
und dem Mittelmeer umfasst. Der Schweizer Sport bemüht sich um die Spiele 2038.
Erstmals soll ein ganzes Land als Gastgeberin auftreten, mit
Wettkampfstätten in zehn Kantonen in allen drei Sprachregionen. Das IOK
und Swiss Olympic haben begriffen: Anders als dezentral lässt sich
Olympia im Alpenraum nicht mehr realisieren.
Als
Ideal werden vielerorts noch immer die Spiele 1994 in Lillehammer
herbeigezogen: kurze Wege, tiefe Kosten, viel Nachhaltigkeit – ein
skandinavisches Wintermärchen, das es in dieser Form nicht mehr geben
wird. Winterspiele haben sich verändert. Traten in Norwegen noch 1280
Athletinnen und Athleten in 61 Wettbewerben an, werden in diesem Jahr
3500 Sportlerinnen und Sportler in 116 Wettkämpfen erwartet.
Diesen
Ausbau hat das IOK herbeigeführt, weil die Vermarktung der Winterspiele
zu einem ebenso grossen Problem geworden ist wie die Suche nach
geeigneten Ausrichtern. Ein jüngeres Sportpublikum schaut sich kaum
stundenlang einen 50-Kilometer-Langlauf oder dreissig Skifahrer an,
welche die immergleiche Piste hinunterrasen. Es konsumiert
Videoschnipsel in den sozialen Netzwerken.
Das aufgeblasene Wettkampfprogramm verfehlt die Wirkung
Das
IOK hat das Olympiaprogramm als Reaktion auf diese Entwicklung stetig
aufgeblasen, in der Hoffnung, mit neuen Sportarten auch ein neues
Publikum anzulocken. Im Vergleich mit Lillehammer gibt es nun sieben
statt zwei Freestyle-Disziplinen, dazu fünf verschiedene Formen von
Snowboardwettkämpfen.
Diesen
Ausbau gilt es in Zukunft zu vermeiden oder rückgängig zu machen. Er
hat die erhoffte Wirkung auf die Attraktivität der Spiele verfehlt.
Immer neue Disziplinen sind vielmehr Kostentreiber bei der
Sportinfrastruktur. Den Ruf der Olympischen Winterspiele werden sie
nicht retten.
Es
braucht tiefergehende Reformen. Es gibt Pläne, ab 2030 Crosslauf und
Radquer-Rennen in das Programm zu integrieren. Vertreter klassischer
Wintersportarten lehnen das ab, weil in der olympischen Charta steht,
nur Sportarten, die auf Schnee und Eis ausgetragen würden, gehörten an
die Winterspiele.
Diese
Haltung zeugt von wenig Weitblick, sie ist sogar fahrlässig. Die
Winterspiele brauchen ein Aushängeschild mit globaler Strahlkraft.
Dieses Kriterium erfüllt keine Wintersportart, weder der in Europa
beliebte Skisport noch das Eishockeyturnier – selbst wenn, wie in diesem
Jahr, die Spieler der National Hockey League (NHL) teilnehmen. Dass die
IOK-Präsidentin Kirsty Coventry diese Woche in Mailand eine umfassende
Überprüfung des olympischen Programms ankündigte, ist daher zu
begrüssen.
Verlegung von Basketball zu den Winterspielen wäre sinnvoll
Als passendes Aushängeschild der Winterspiele wird immer wieder Basketball ins Gespräch gebracht. Die Sportart erfährt auf der ganzen Welt einen Zulauf
an Publikum. Sie gehört an Sommer-Olympia zu den Quotenrennern, doch
diese Spiele könnten den Wegfall verkraften, sie haben im Gegensatz zum
Winter genügend Weltsportarten im Programm. Eine Verlegung des
Basketballs mit den Superstars aus der NBA würde den Winterspielen mehr
Gewicht verleihen – und eine jüngere Zuschauergruppe erschliessen. Nach
Coventrys Äusserungen dürfte die Debatte über den Umbau der Winterspiele
Fahrt aufnehmen.
Neue
Wege sind auch im Vergabeprozess gefragt. Es ist ineffizient und wenig
nachhaltig, Olympia alle vier Jahre an andere Gastgeberstädte zu
vergeben. Die dann jedes Mal ein neues Konzept erarbeiten, neue
Sportstätten bauen und Verkehrsinfrastruktur sowie Hotellerie auf
Olympianiveau bringen.
Vielmehr
sollte das IOK in Europa, Asien und Nordamerika je eine oder zwei
Destinationen ausmachen, die im Turnus die Winterspiele austragen
dürfen. Damit würden sich Investitionen in die Infrastruktur lohnen. Und
das IOK bewiese mit diesem radikalen Schritt, dass ihm an der dringend
nötigen Reform der Olympischen Winterspiele gelegen ist.